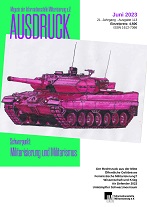IMI-Analyse 2023/26
Ungebrochen oder modernisiert?
Vom preußischem Militärstaat bis zur Bundeswehr und wieder zurück
von: Andreas Seifert | Veröffentlicht am: 26. Juni 2023
Wir befinden uns momentan mitten in einer Debatte um das Verhältnis der Deutschen zum Militär. Im Raum steht die Forderung, dass sich das Mindset ändern müsse, unter dem „wir Deutschen“ Militär und Verteidigung betrachten – dass die „Zeitenwende“ nur dann „erfolgreich“ sei, wenn das Verhältnis zwischen Gesellschaft und militärischer Gewalt neu austariert wird. Die fatale Verkürzung dieser Debatte ist eine um Material, um Ausstattung, um Reichweiten und um Abschreckungspotentiale. Längst ist aber auch klar, dass mehr Panzer, mehr Flieger, auch mehr Personal benötigt werden, um sie zu bedienen. Die Ressource Personal ist allerdings nicht so einfach zu rekrutieren und die Reaktivierung der Wehrpflicht wird nicht die „Qualität“ und Masse hervorbringen, die sich das Militär wünscht – und dieses neue Personal sollte zudem mit einem „neuen“ Soldatenbild daherkommen: motiviert, „unsere Werte“ zu verteidigen. Die Erhöhung der militärischen Budgets drängt auch diese Fragen in den Vordergrund, denen wir uns als Gesellschaft nicht reflexhaft entziehen sollten: Wer Hurra schreit, wenn es um Aufrüstung geht, findet sich im Zweifel in der Gesellschaft wieder, die militärische Tugenden (wieder) zum Maß erhebt – nicht nur in Deutschland.
Militarismus als historische Epoche?
Das deutsche Kaiserreich ist die Folie, auf der sich die Grundzüge des Militarismus erläutern lassen: der Zuschnitt der gesamten Gesellschaft auf Militär und Kriegskultur, ihre Durchdringung durch die Geisteshaltung von Befehl und Gehorsam. Historisch ist es diese Formation, die die Industrialisierung des Krieges und den Ersten und Zweiten Weltkrieg nicht nur möglich, sondern auch zwangsläufig gemacht hat.
Die Aufstellung stehender Heere im 18. Jahrhundert, die sich insbesondere in den protestantischen Ländern (Preußen, Schweden, Hessen-Kassel) in großen Anteilen (bis zu 7%) der Bevölkerung niederschlug, ist als Anfangspunkt eines auf den Erhalt und den Ausbau militärischer Stärke ausgerichteten Staates zu sehen. Die Verknüpfung mit nationalistischen Idealen ließ das Militär als „Kern“ des Staates erscheinen, der im König/Kaiser personifiziert wurde. Die preußische Pickelhaube wurde dabei in Deutschland nicht nur zum Sinnbild der politischen Macht, die von Preußen und Berlin ausgeht, sondern begleitet auch als Ausdruck militärischer Strenge und Ordnung die Reichseinigung von 1870 (siehe Karikatur). Der zivile Patriot, der seinem Staat im Kriegsfalle beispringt, ist sozusagen durch die Geisteshaltung militaristisch vorbereitet. Dies bedingt einen ggf. graduell abgemilderten, doch permanent vorhanden Einfluss des Militärs auf den Staat bzw. seine Spitzen – die Größe der militärischen Organisation an sich und ihre Präsenz in allen Entscheidungen machten das Militär im Deutschland des 19. Jahrhunderts zu einem wesentlichen Akteur. Die Rüstungsindustrie, die diesen Apparat mit Material und später auch mit immer mehr Technik befütterte, konnte analog an Gewicht gewinnen. Die Technisierung des Krieges ließ diesen Industriezweig auch zum Innovationsmotor der Wirtschaft insgesamt werden. Die massenhafte Produktion und der spätere Einsatz von Kriegsgerät gebar auch das Bedürfnis der Standardisierung, die sich z.B. in der Gründung des Deutschen Instituts für Normung (DIN / bis 1917: Normalienauschuß für den Maschinenbau) niederschlug und bis heute tief in das Wirtschaftsleben aller eingreift.
In Deutschland setzte sich unter Wilhelm II (1859-1941, Kaiser von 1888 bis 1918) der Militarismus als herrschende Norm durch. Seine Regierungszeit war begleitet von einer massiven Aufrüstung der Streitkräfte. Insbesondere die Marine erfuhr, auch als Träger kolonialer Ambitionen, einen gigantischen Ausbau. Deutschlands „Platz an der Sonne“ (Reichskanzler Bülow 1897) war militärisch zu erobern und abzusichern. Das damit einhergehende Menschenbild, geprägt von kultureller Überlegenheit und Rassismus, wurde zum Kernbestandteil dieser Bestrebungen und mag die besondere Brutalität deutscher Kolonialtruppen (Boxerkrieg 1901, Völkermord an den Herero/Nama 1904, Niederschlagung des Maji-Maji-Aufstands 1905) erklären. Dies lebte sich auch als massive Repression im Inneren Deutschlands aus.
Die Mobilmachung zum Ersten Weltkrieg setzte auf diesem Fundament auf und gebar den Hurra-Patriotismus, der den millionenfachen Tod von Zivilisten wie Soldaten zwischen 1914 und 1918 zu ignorieren bereit war. Das industrialisierte Sterben in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs änderte den Blick auf den Krieg – aber es führte nicht zu einer Überwindung des Militarismus nach 1918.
Die Aufrüstungs- und Gesellschaftsprogramme der NSDAP knüpften nach 1933 an diesen Militarismus bruchlos an: Zielstrebig wurde das Land re-militarisiert. Die Ausrichtung der Wirtschaft, Infrastruktur und Ressourcenbeschaffung auf den Krieg erfolgte bei den Nazis ungleich vollständiger als noch im Kaiserreich. Die Wirtschaft wurde zur Kriegswirtschaft – die Industrie wurde zum Partner, Belegschaften zu Gefolgschaften. Die paramilitärisch durchstrukturierte Hitlerjugend stellte sicher, dass militärische Ideale schon früh in die Erziehung einflossen – ab 1939 war eine Mitgliedschaft Pflicht. Abgesichert durch Repression und Verfolgung, durch Feindbilder und Rassismus, war die Gesellschaft bei Kriegsbeginn militärisch durchdrungen: Krieg und Shoa waren die Folge.
Ideen der Überwindung
Die junge Bundesrepublik setzte sich hiervon bewusst ab und gab sich eine Verfassung, die jeden Anschein einer positiven Anknüpfung an dieses militaristische Erbe zu vermeiden suchte. In der Deutschen Demokratischen Republik setzte man vor allem auf die Einbindung in das sozialistische Lager und die Abgrenzung von personellen Kontinuitäten zum faschistischen Militärapparat. Die gesellschaftliche Debatte um die Wiederbewaffnung Deutschlands nach dem Ende des Krieges reflektierte diesen Anspruch. Die pazifistische Grundstimmung in der Bevölkerung verhinderte aber nicht, dass erst paramilitärische Einheiten (Kasernierte Volkspolizei/Bundesgrenzschutz) und später reguläre Truppen (Nationale Volksarmee/Bundeswehr) aufgestellt wurden.
Der „Bürger in Uniform“ und die „Innere Führung“ sollten im Westen verhindern, dass sich der Korpsgeist der Wehrmacht wieder ausbreiten konnte, obwohl man mit dem militärischen Führungspersonal an die Wehrmacht anknüpfte. Eine Armee, die demokratische Werte reflektiert und an das Parlament gebunden ist, sollte eine der Garantien der Bewahrung der Demokratie werden. Eine andere Garantie bestand darin, den einzelnen Soldaten in die Pflicht zur Abwägung zu nehmen, ob ein empfangener Befehl ein Vergehen oder Verbrechen zum Inhalt haben würde und im Zweifel genau diesem Befehl keinen Gehorsam zu leisten – er schwor keinen Eid auf einen Führer, er legte ein Gelöbnis zur Verteidigung ab. Von Beginn an wurde bezweifelt, ob dies ausreicht, die militärische Tugend zum Gehorsam zu durchbrechen und eine wahrhaft demokratische Armee zu schaffen (siehe dazu auch den Beitrag von Markus Euskirchen in diesem Heft).
Im Deutschland der Blockkonfrontation standen zu beiden Seiten der Mauer große Truppenaufgebote und tausende Panzer bereit. Im Schatten des Eisernen Vorhangs war viel Militär vorhanden und an die Landesverteidigung gebunden. Die zur Aufrechterhaltung des Status Quo in der Blockkonfrontation erforderliche militärische Infrastruktur war, anders als die prachtvollen wilhelminischen Kasernen und Exerzierplätze, keineswegs davon geprägt, die Großartigkeit des Militärs zu betonen, sondern funktional und zurückgenommen. Dafür war die Landschaft an sich militärisch durchdrungen und alle funktionalen Elemente zur Verteidigung gegen den Feind im Osten/Westen ausgerichtet. Dies ist auch noch 30 Jahre nach Ende der Blockkonfrontation an der Lage bestimmter Pipelines und Kommunikationslinien nachvollziehbar – die Anbindung des Flughafens Frankfurt an das NATO-Pipelinenetz macht dies z.B. deutlich.
Die Blockkonfrontation legte die deutschen Armeen zu beiden Seiten der Mauer auf eine spezifische Rolle fest: Landesverteidigung. Mit dem Wegfall der Konfrontation nach 1989 fiel auch die Landesverteidigung als Existenzberechtigung solch großer Heere weg. Die „Friedensdividende“ schlug sich unmittelbar in der Reduzierung von Kampfkraft und Zahl der Soldaten sowie im Abbau von Produktionskapazitäten nieder. Der Dienst an der Waffe, verbindlich als Wehrpflicht geregelt, der vorher dafür sorgte, dass der männliche Teil der Gesellschaft zwangsweise mit der Armee und dem Militärischen in Berührung kam, wurde mehr und mehr zur Ausnahme, die Verweigerung desselben zur Regel. Faszinierenderweise sind einige dieser Verweigerer von einst heute durchaus die größten Verfechter bellizistischer Tendenzen. Mit dem Ende der Blockkonfrontation, so das heute vermittelte Narrativ, beginnt der „Abstieg der Einsatzfähigkeit“, die Demontage der Bundeswehr – was bei genauerem Hinsehen nicht stimmt.
Phönix aus der Asche
Die Dynamik der Entwicklung nach 1990 war eine der Neuerfindung der NATO und der Bundeswehr. In erster Linie war sie eine Neufassung des Streitkräfteauftrages, der in kleinen Scheiben von der Landesverteidigung hin zu einer „global einsetzbaren Truppe“ verlief: Kleinere Schritte wie die „Quantitative Abrüstung und qualitative Aufrüstung“, die Aufstellung von interventionsfähigen Truppen (Kommando Spezialkräfte 1996), die Teilnahme am völkerrechtswidrigen Jugoslawienkrieg 1999 bis hin zur Aussage, Deutschland werde „auch am Hindukusch verteidigt“. Dieser Weg, den die IMI als einen Prozess zunehmender Militarisierung beschrieben, begleitet und kritisiert hat, ist dabei keineswegs auf den Umbau der Bundeswehr beschränkt. Er war vor allem ein Umbau in den Köpfen von Soldaten und Politikern, der in Konzepten wie dem Thesenpapier „Neue Macht, neue Verantwortung“ (2013) gipfelte. Diesem Anspruch wurde die alte Bundeswehr geopfert – nicht der Bürger in Uniform verteidigt die Bundesrepublik, sondern ein professioneller Soldat wird zum Mittel internationaler Politik, die sich sichtbar von den Interessen der deutschen Bevölkerung entfernt und vornehmlich wirtschafts- und ordnungspolitische Ziele bedient. Das Parlament wurde immer öfter erst im Nachhinein von den immer häufiger als Kommandooperationen geführten Einsätzen informiert und stimmte einmütig immer abenteuerlicheren Bundeswehreinsätzen zu. Während die militärischen Kapazitäten für die Landesverteidigung geschliffen wurden, konnte die Technik für den potentiellen Auslandseinsatz gar nicht opulent genug sein. Die kleinen Mengen Material, die man bei der Industrie bestellte, wurden immer teurer, Projekte zu regelrechten Langzeitaufgaben, die zunehmend mehr Personal und Geldmittel banden, ohne dass damit noch die Relation zu einer gedachten oder auch gewünschten Einsatzfähigkeit bestand.
Festzuhalten bleibt, dass dies kein Prozess angeblicher Alternativlosigkeit (und schon gar kein „Sparkurs“) war, sondern eine bewusste Entscheidung für ein neues Modell militärischer Legitimität. Das deutsche Militär begründete sich nicht mehr aus der Notwendigkeit der Landesverteidigung, sondern aus der Selbstzuschreibung einer „Verantwortung“, die Deutschland international wahrzunehmen habe. Markiert wird dies heute noch durch sogenannte „Bündnisverpflichtungen“ (an Material und Einsatzbereitschaft), die man überhaupt erst selbst geschaffen hatte, und unterstellter „Erwartungen unserer Partner“ (in Bezug auf militärische Beiträge), die man „nicht enttäuschen dürfe“. Hiermit hebelt man die militärische Souveränität und auch den Souverän Parlament weitgehend aus und unterwirft das Militär einem politischen Kalkül. Indem das Militär so zum Instrument der Politik geworden ist, deren Handeln sich immer weniger an den konkreten Interessen der Wähler orientiert, entfremdet es sich von der ursprünglichen Aufgabe der Landesverteidigung.
Psychologisch wurde dies abgefangen durch den Versuch, das Militär auf andere Weise wieder in das Leben der Bürger zu projizieren. Die Debatten um Terroristen, Geiselbefreiungen, Schutz von Handelsrouten, Flüchtlingsabwehr etc. sind dabei Hilfskonstrukte, die zur Legitimität der Bundeswehr beitragen sollten – dargelegt und debattiert als Versicherheitlichung aller Lebensbereiche, die in eine Militarisierung dieser Bereiche mündete.
Es scheint keine Rolle zu spielen, dass die militärischen Einsätze – prominent natürlich der Afghanistan-Einsatz – mit den Zielsetzungen, mit denen das Parlament sie beschlossen hatte, scheitern. Es spielt keine Rolle, welche Schäden diese Einsätze vor Ort hinterlassen oder wie viele Menschen dabei sterben. Es spielt nur eine geringe Rolle, wie viele Bundeswehrsoldaten bei diesen Einsätzen sterben, verletzt werden oder traumatisiert zurückkehren. Diese Frage nach eigenen „Verlusten“ vermochte vor allem eine Debatte um „mehr Material“ oder auch die Automatisierung von Krieg zu bedienen (Drohnen als sichere Möglichkeit, woanders zu töten, ohne eigenes Personal zu gefährden). Die deutsche Gesellschaft blendet die realen Kosten weitgehend aus. Ebenfalls ausgeblendet wird, dass sich der Zustand der Truppe in diesem Prozess ändert, deren Eigenwahrnehmung sich anpasst und neue Perspektiven auf den möglichen Auftrag der Armee als Ganzes entstehen. In einem Arbeitspapier der Bundesakademie für Sicherheitspolitik wurde dies 20221 als „Afghanisierung“ der Bundeswehr beschrieben – einer Bundeswehr, in welcher der Kampfeinsatz im Ausland als höherwertig eingestuft wird und auch als der Karriere förderlicher als die Bündnisverteidigung, selbst wenn diese z.B. in Litauen geleistet wird.
Angesichts dieses Prozesses muss die Frage erlaubt sein, wie viel von dem Bürger in Uniform, der sich und die Bundesrepublik vom Militarismus des wilhelminischen Reiches und der Wehrmacht abgrenzen sollte, noch verblieben ist. Und auch, ob die 2016 in den Bundeswehrauftrag zurückgekehrte Landesverteidigung in der Lage ist, die Tendenzen der Verselbstständigung der Bundeswehr zu überwinden.
Reflex oder Plan?
Die 2022 ausgerufene Zeitenwende, inszeniert als ein „Aufwachen“, als der plötzlich fühlbare Ekel vor (bestimmten) autokratischen Systemen, schafft den Begründungsrahmen für Pläne, die schon längst bereit lagen. Das Feindbild Russland und das Schreckgespenst des chinesischen Aufstiegs sind dominante Figuren in einem sich mehr und mehr verengenden Debattenraum. Die so geschaffene „Bereitschaft“ in der Bevölkerung, nicht nur einmalig mehr Geld für Rüstung bereit zu stellen, sondern auch darüberhinausgehend diesen Geldhahn dauerhaft aufgedreht zu lassen, ist die neue Folie, auf der sich die Bundeswehr erheben soll. Der anstehende Verteilungskampf um Haushaltsanteile scheint für die Bellizisten schon gewonnen: eine Debatte darüber, ob man das alles braucht und welches Material man wirklich wofür braucht, existiert nicht. Hier ordnen sich die Republik und ihre Vertreter erstmals wieder dem Diktum des Militärs und einer kleinen sicherheitspolitischen Elite unter. Die CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg schlug jüngst vor, die durch Gesetze limitierte Kooperation von Bundeswehr und Behörden zu intensivieren und militärische Anforderungen in allen Bereichen behördlicher Entscheidungen zu berücksichtigen2 – Kaiser Wilhelm hätte seine Freude.
Anmerkungen
1 Philipp Fritz, Dominik Steckel, Mindset LV/BV: Das geistige Rüstzeug für die Bundeswehr in der Landes- und Bündnisverteidigung, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Arbeitspapier N.9/2022.
2 Siehe auch Andreas Seifert, Aufrüstung im Inneren, BaWü-CDU prescht bei Militarisierung vor, IMI-Standpunkt 15/2023.